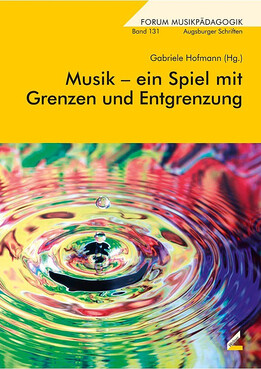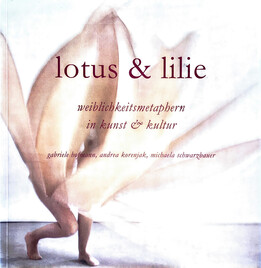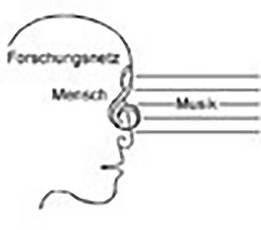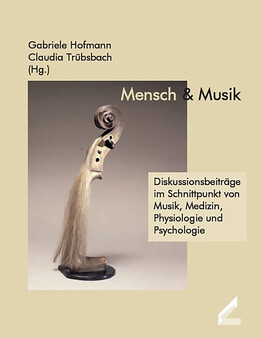Konzipierte Tagungen / Vortragsreihen / Projekte
2024 Musik Macht Gewalt
Flyer
Tagungsreader
24. – 26. April 2024, Schwäbisch Gmünd
Musik übt oftmals eine eindrückliche Wirkung auf Menschen aus. Sie bewegt mitunter zutiefst und kann zu einem gewaltigen Erlebensraum werden – diese Macht kommt ihr unabhängig von Stilrichtungen und Genres zu. In vielfältiger Weise werden mit und durch Musik emotionale Zustände verarbeitet oder zum Ausdruck gebracht.
Es werden aber auch zahlreiche Aspekte von Macht und Gewalt in der Musik selbst verarbeitet: Musik kann im Dienst von Macht und Gewalt funktionalisiert werden oder zu Widerstand dagegen auffordern. Sie kann als Folie für das Darstellen, Widerspiegeln, Konsolidieren, Kritisieren und Unterlaufen von Macht dienen – in verschiedenen Zeiten, Epochen, Kulturen und Genres sowie auf den Ebenen von Produktion und Rezeption und im pädagogischen Bereich.
Insgesamt finden sich zahlreiche diskussionswürdige Facetten zum Tagungsthema, die durch die drei gedanklichen Säulen strukturiert werden:
• Musik Macht Gewalt – Macht Musik Gewalt?
• Gewalt – Ambivalenzen im Wahrnehmen und Handeln
• Machtstrukturen in musikpädagogischen Kontexten
Diese Aspekte werden multiperspektivisch verhandelt. In den Diskurs treten ein Psychoanalytiker, eine Musikpsychologin, ein Musikwissenschaftler, ein Mediensoziologe, eine Literatur-
wissenschaftlerin, eine Musiksoziologin, eine Musikpädagogin und eine Musikdidaktikerin sowie Studierende. Es ist ein Anliegen der Tagung für das gesellschaftspolitisch relevante Thema zu sensibilisieren und Diskussionsräume für alle Anwesenden zu öffnen. Das Abendprogramm lädt mit einer themenbezogenen Lesung dazu ein, über das wissenschaftliche Denken hinauszugehen und in die emotionale Welt der Literatur einzutauchen, denn „Musik überhaupt ist etwas Furchtbares!“.
2021: Tagung (Deutsch-)Rap und Gewalt – Ambivalenzen und Brüche
Inhaltliche Konzeption und Durchführung: Gabriele Hofmann, Nazli Hodaie, Daniel Rellstab (alle PH Gmünd) unter Mitwirkung von Eva Kimminich (Universität Potsdam) und Rosa Reitsamer (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien)
22. – 24. April 2021, Schwäbisch Gmünd /Pandemiebedingt virtuelles Format
Wurzelnd in der US-amerikanischen Hip-Hop-Bewegung hat sich der (Deutsch-)Rap mittlerweile zu einer der größten jugendkulturellen Strömungen entwickelt. Im Laufe seiner Geschichte wurde er als Medium der Gesellschaftskritik oder als Stimme der Minderheit(en) eingesetzt, er dient der Erzeugung von Party-Stimmung, als Mittel zur Selbststilisierung oder als Instrument der Ab- und Ausgrenzung. Dieser Vielfalt entsprechend entwickelten sich in den letzten Jahrzehnten unterschiedliche Subgenres, z.B. Conscious-Rap, Queer-Rap oder „Gangsta“-Rap. Obwohl am heftigsten kritisiert, wird insbesondere letzterer aufgrund spezifischer Marktmechanismen jugendkulturell am meisten rezipiert. Politisch und sozialkritisch motivierter Rap erlangt hingegen in medialer Hinsicht eine eher geringe Präsenz, wird jedoch in spezifischen Communities ebenso rege rezipiert.
Phänomene der Gewalt sind eng mit der Hip-Hop-Bewegung verbunden, da diese als Reaktion auf soziale und institutionelle Gewalt entstand. Diese Perspektive manifestiert sich nach wie vor in politisch motivierten Rap-Subgenres, in denen die kritische Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Formen von Gewalt im Vordergrund steht. Bei anderen Rap-Genres, z.B. dem „Gangsta“-Rap, findet dagegen eine Verherrlichung von Gewalt unter Verwendung expliziter Worte, Sprachbilder, Motive und visueller Gestaltungsmerkmale statt; eine diesbezüglich legitime Kritik beschränkt sich allerdings meist auf die Oberfläche der Darstellung, etwa vorhandene Brüche und Widersprüche finden weniger Berücksichtigung. Gleichzeitig müssten die kritisierten Darstellungsmuster auch im Kontext weiterer gesellschaftlicher Diskurse, etwa zu Migration und Zugehörigkeit oder Sexualität und Männlichkeit, interpretiert werden.
Zwischen den Polen „offene Gewaltverherrlichung“ und „offene Gewaltkritik“ spannt sich im Rap somit ein Feld auf, das einer näheren Analyse und Auseinandersetzung bedarf. Hier gilt es, die komplexen Modi und Mechanismen der Gewaltdarstellung und der Gewaltkritik, die Akteur*innen, die diese produzieren und rezipieren, die Instanzen, die an ihrer Verbreitung und Popularisierung mitwirken und die bestehenden Wechselwirkungen im Feld des Rap in den Blick zu nehmen:
Wie wird produktionsseitig an der Wirksamkeit der Darstellung gearbeitet, um Rezipient*innen zu erreichen? Inwiefern werden Gewalt und Rap im öffentlichen Diskurs verlinkt? Und wie stehen jugendliche Rezipient*innen zu den dargestellten Gewaltphänomenen, inwiefern vermögen sie diese zu reflektieren?
Vor dem Hintergrund vorangehender Überlegungen setzt sich die Tagung mit dem Gewaltmotiv und seiner (multimodalen) Darstellung im (Deutsch-)Rap auseinander. Die Facetten der Gewaltdarstellung im (Deutsch-)Rap und deren ggf. vorhandene Brüche und Ambivalenzen werden einerseits auf der Ebene der Produktion fokussiert. Andererseits erfolgt ein Blick auf die Rezeptionsprozesse, Produktionsmechanismen und -instanzen, die auf eine möglichst breite Rezeption abzielen. Ziel ist es, das Phänomen Gewalt im (Deutsch-)Rap in den Kontext gesellschaftlich relevanter, auch medialer Diskurse einzubetten und dabei auf die Vielfalt, Ambivalenzen und Brüche seiner Darstellung aufmerksam zu machen, um seine Entwicklungen und Erscheinungen aus einer vernetzen Perspektive aufzuspüren.
Folgende Stichworte gelten als mögliche Impulse für die Auseinandersetzung: - Gewalt und Rap- Subgenres (z.B. Conscious-Rap, Queer-Rap, „Gangsta“-Rap) - Brüche, Widersprüche und Ambivalenzen in der Darstellung der Gewalt - Gesellschaftskritische Aspekt der Gewaltdarstellung - Gewalt und Othering - Gewalt im Deutschrap im Kontext der Migrations-, Gender- und Sexualitätsdiskurse - Hegemoniale Männlichkeit bzw. Konstrukte von Männlichkeit und Weiblichkeit - Produktionsmechanismen zur Erzeugung der Wirksamkeit der Gewaltdarstellung - Diskurse über Gewalt, Kriminalität und Rap - Gewalt, Authentizität, Realness und Credibility - Zwischen Verharmlosung und Verherrlichung: Rezeptionsweisen der Gewalt im (Deutsch)Rap
Tagungshomepage: www.deutschrap2021.de. Pandemiebedingt erfolgte die Durchführung der Tagung virtuell.
Es wird ein Tagungsband herausgegeben (erscheint 12/2023).
2014: Tagung Musik – ein Spiel mit Grenzen und Entgrenzung
Inhaltliche Konzeption, Organisation und Durchführung: Gabriele Hofmann
Musik – ein Spiel mit Grenzen und Entgrenzung
17.-18. Januar 2014 Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd
Musik wird einerseits als ein begrenztes Phänomen wahrgenommen: Sie ist häufig regional angesiedelt, zeitlich zuordenbar, unterliegt oftmals einem definierten Verwendungszweck, ist Strukturen unterworfen, zeichnet sich in der Regel durch klar umrissene Abläufe aus und kann zu einem abgegrenzten Analysegegenstand werden.
Musik lebt aber auch davon, Grenzen zu überschreiten bzw. aufzulösen, sie ist Bestandteil von Entgrenzungs-Ritualen, sie gilt als weltumspannende Sprache und kennt damit (bisweilen) keine Grenzen.
In einem interdisziplinären Kontext wurde das beschriebene Spannungsfeld, in dem sich Musik entfaltet, ausgeleuchtet. Musik wird gespielt – und sie stellt ein Spiel mit Grenzen und Entgrenzung dar.
Im Einzelnen ging es um interdisziplinäre Fragestellungen zu folgenden Themenbereichen:
- Verortung von Musik innerhalb regionaler Grenzen sowie deren Ausweitung
- Ritualisierte Entgrenzung des Menschen durch Musik
- Musik als Darstellungsmedium von Grenzen und Entgrenzung
Musik kann individuell oder kollektiv zu Abgrenzungs- oder Entgrenzungsbedürfnissen der Ausübenden oder Rezipienten genutzt werden. Daraus resultiert eine grundlegende Fragestellung, die im Tagungskontext bearbeitet wurde:
In welchen kulturellen und situativen Kontexten bzw. aus welchen Gründen wird Musik als Mittel der Begrenzung oder Entgrenzung wahrgenommen und verwendet?
Referent/innen: Prof. Dr. Ruprecht Mattig (Innsbruck), Prof. Dr. Hartmut Möller (Rostock), Prof. Dr. Franz Josef Wetz (Schwäbisch Gmünd), Ao.Prof. Dr. Barbara Dobretsberger (Salzburg), Dr. Dr. Andrea Korenjak (Wien), Dipl.-Psych. Andrea Baldemaier (Lüneburg), Dr. Thomas Fritz (Leipzig), Prof. Dr. Hermann Ullrich (Schwäbisch Gmünd), Prof. Dr. Gabriele Hofmann (Schwäbisch Gmünd).
Es wurde ein Tagungsband herausgegeben.
2011: Projekt „Unerhört hörbar“ – Tag des Hörens
Inhaltliche Konzeption und Organisation: Gabriele Hofmann Durchführung gemeinsam mit Studierenden
Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd
Unter dem Motto "Unerhört hörbar" lud die Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd alle Interessierten auf eine Hörreise ein. Die Besucher des Tags des Hörens konnten an einer Schallpegel-Mess-Station testen, welche Lautstärke ihr eigener mp3-Player erreichen kann. An einer Hörstation konnte man mit eigenen Ohren nachvollziehen, wie Beethoven hörte, als sich seine Schwerhörigkeit - eine sogenannten Otosklerose - einstellte und verschlechterte. Ein anderes Thema lautete: "Wie hören Tiere?". Außerdem gab es einen Klangraum, in dem Kinder und Jugendliche verschiedene Geräusche und Klänge erraten konnten. Die Kinder waren zudem zu einem geführten Hörspaziergang eingeladen. Unter Anleitung konnten sie mit verbundenen Augen und von Studierenden sicher geführt, neue Hörerfahrungen machen.
Ein Höhepunkt am Tag des Hörens war der gemeinsame Vortrag von Alfred Hinderer und Christiane Waibel zum Thema "(Musik-)Hören will gelernt sein - Mit und ohne Hörschädigung". Die Pädagogische Hochschule kooperiert bei diesem Vortrag mit der Schule für Hörgeschädigte St. Josef.
"Unerhört hörbar" war eine Initiative der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd, die sich zum Ziel setzt, einen Beitrag zur Prävention von Hörschäden zu leisten und gleichzeitig zu einer Hörsensibilisierung beizutragen.
Das Hören ist ein für die Musikpädagogik und Gesundheitsprävention gleichermaßen bedeutsames Thema. Der Tag des Hörens wurde von der AOK unterstützt, die auch einen Informationsstand mit Materialien zum Thema Hören bereit hielt.
2010: Projekt „Musikvermittlung“ Philemon & Baucis
Inhaltliche Konzeption und Organisation: Gabriele Hofmann Durchführung: Gabriele Hofmann mit Studierenden der Abteilung Musik
Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd
Die Pädagogische Hochschule kooperierte 2010 erstmals mit dem Festival Europäische Kirchenmusik.
Zum Musiktheater-Projekt "Philemon und Baucis" (22. Juli, Augustinuskirche) gab es vorbereitende, pädagogisch-künstlerische Veranstaltungen der Kinder-Uni und der Seniorenhochschule Schwäbisch Gmünd. Unmittelbar vor dem Konzert fand ein Künstlerinnengespräch mit der Komponistin und Dirigentin des Abends (Konstantia Gourzi) statt (Moderation: Gabriele Hofmann).
Eine Besonderheit des Projekts ist, dass Studierende des Fachs Musik im
Rahmen eines Seminars Vermittlungskonzepte für das Werk von Gourzi/Haydn erarbeiteten und bei der Kinder-Uni und Seniorenhochschule selbst didaktisch tätig werden konnten. Hierbei wurden drei Ziele miteinander verbunden:
- Es fand eine Kooperation zweier für Einrichtungen des Gmünder Kulturlebens (Festival Europäische Kirchenmusik und Pädagogische Hochschule) statt.
- Die Studierenden bekamen Gelegenheit „Musikvermittlung“ in der Praxis umzusetzen.
- Kinder-Uni und Seniorenhochschule wurden mit der Arbeit des Studierenden-Teams um eine innovative Präsentationsform bereichert.
2010: Symposium Musik & Gewalt
Inhaltliche Konzeption, Organisation und Durchführung: Gabriele Hofmann.
Internationale Musikschulakademie Kapfenburg, Lauchheim
Das wissenschaftliche Symposium sollte Ausgangspunkt für weitere praktische Aktivitäten – konkret vor allem im schulischen Bereich und in der Jugendarbeit – sein. Es ging um Sensibilisierung gegen Gewaltmusik, so dass davon ausgehend in einem Zusammenschluss von Politik, Wissenschaft, Schulen und Jugendeinrichtungen verschiedene Initiativen für die im Gange befindliche Etablierung von Gewaltmusik im Umfeld Jugendlicher gestartet werden können. Es konnte z.B. verdeutlicht werden, dass der Zugang zu Gewalt durch Musik sehr subtil und von den Jugendlichen selbst oft zunächst unbemerkt stattfindet, weil auf den ersten Blick nicht die (gewaltsamen) Inhalte und Texte im Mittelpunkt stehen. Vielmehr geht es den Jugendlichen zunächst oft um Nutzung von Musik, um die Zugehörigkeit zu einer Clique zu demonstrieren, da Musik zu einem wesentlichen Merkmal der Jugendkulturen gehört. Für diese und andere Aspekte hat das Symposium sensibilisiert, so dass im besten Fall daraus langfristig tatsächlich Projekte an der Basis entstehen können.
Angeregt durch das Symposium entstand eine Publikation zum Thema „Musik & Gewalt – Aggressive Tendenzen in musikalischen Jugendkulturen“ mit Beiträgen von Prof. Dr. Georg Brunner, Benjamin Elser, Prof. Dr. Erika Funk-Hennigs, Dr. Michael Herschelmann, Prof. Dr. Gabriele Hofmann, Dr. Stefanie Rhein, Dr. Mathias Gutscher/Prof. Dr. Holger Schramm/Prof. Dr. Werner Wirth.
Es wurde ein Tagungsband herausgegeben.
2005: Symposium Lilie und Lotus. Weiblichkeitsmetaphern in Kunst und Kultur.
Symposion in Kooperation mit der Residenzgalerie Salzburg. Konzeption und Durchführung: Michaela Schwarzbauer, Gabriele Hofmann und Andrea Korenjak
Residenzgalerie Salzburg
Das Symposium widmete sich aus interdisziplinärer Perspektive (Kunst-, Literatur-, Musik- und Sprachwissenschaft sowie Psychologie) der Symbolik von Lotus und Lilie, der Bedeutung von Mythenbildung, den Ausdrucksformen von Körperlichkeit sowie deren Manifestationen im Bereich der Alltagskultur.
Es wurde ein Symposiumsband herausgegeben.
2005: Symposium Mensch & Musik - Musikwirkungsforschung in Österreich
Inhaltliche Konzeption und Organisation: Gabriele Hofmann.
Schloss Frohnburg, Salzburg
Das Symposium stellte Forschungsarbeiten zum Thema Musikwirkung aus den Bereichen Schmerzforschung, Chronobiologie, Hirnforschung, Komaforschung u.a. sowie aus musikwissenschaftlich und musikpädagogisch verankerten Projekten mit interdisziplinärer Ausrichtung vor einer Fachöffentlichkeit zur Diskussion.
Der Austausch zwischen den Pionieren der österreichischen Musikwirkungsforschung im Bereich Neurophysiologie Univ. Prof. em. Dr. Gerhart Harrer und Univ. Prof. em. Dr. Hellmuth Petsche mit Vertreterinnen und Vertretern heutiger Forschungsrichtungen war Ausgangspunkt für weiterführende Forschungsperspektiven.
2004/05: Ringvorlesung Identität und Kreativität an der Universität Mozarteum Salzburg
Idee, inhaltliche Konzeption und Gesamtorganisation: Gabriele Hofmann.
Ziel dieser Ringvorlesung war es, Studierende der Musikpädagogik auf wissenschaftlicher Ebene zu einer kritischen Auseinandersetzung mit den Themen „Identität und Kreativität“ zu bewegen. Die Referenten waren Wissenschaftler aus den Bereichen Musik- und Kulturwissenschaft sowie Musikpädagogik: A.o. Prof. Dr. Christian Allesch, A.o. Prof. Dr. Joachim Brügge, A.o. Prof. Dr. Wolfgang Gratzer, Prof. Dr. Armin Langer, Dr. Stefanie Rhein, Dr. Dr. Andrea Korenjak, A.o. Prof. Thomas Hochradner/A.o. Prof. Michaela Schwarzbauer, Prof. Manuela Widmer.
Die Themen „Identität“ und „Kreativität“ zählen zu den Anliegen der musikpädagogischen und musikwissenschaftlichen Forschung. Sowohl die schulische Musikpädagogik als auch die Instrumental- und Gesangspädagogik werfen Fragen auf, die diese Themen unabhängig voneinander berühren oder aber auch miteinander in Beziehung setzen.
So standen in den letzten Jahren Tagungen der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie z.B. unter den Themen „Die MusikerInnenpersönlichkeit“ oder „Begabung und Expertise“ und internationale Studien setzten sich verstärkt mit Fragen der Identität und Kreativität intensiv auseinander.
Der Themenkomplex „Identität und Kreativität“ sollte als Rahmen für die Ringvorlesung dienen. Hierbei konnte in den einzelnen Beiträgen die Vertiefung nur eines der beiden Aspekte genauso bereichernd sein wie das Aufzeigen von Zusammenhängen zwischen Identität und Kreativität.Um nur eine Auswahl zu nennen, berühren Identität und Kreativität beispielsweise folgende musikpädagogisch relevante (Forschungs-)gebiete:
- LehrerInnen- und SchülerInnenpersönlichkeit
- Musikalische Begabung
- Musikalische Entwicklung in der Lebensspanne
- Musikalische Kulturen
- Performanceforschung/Fragen künstlerischer Interpretation
- Lernbedingungen und -umgebungen für den Musikunterricht
- Regionale Verankerung von Musik und ihre daraus folgenden Ausdrucksformen
- Musikalische Sozialisation
- Präferenzforschung und musikalische Urteilsbildung
- Möglichkeiten und Grenzen didaktischer Vermittlung von Musik etc.
Ob Schulmusik, Instrumentalmusik, Volksmusikforschung, Musiksoziologie, Musikpsychologie, Musikwissenschaft oder Musikalische Früherziehung - diese und andere Bereiche setzen sich mit dem Thema „Identität und Kreativität“ in je eigener Weise auseinander und lieferten ihre Beiträge zu der Ringvorlesung.
Es wurde ein Buch zu der Ringvorlesung herausgegeben.
2003: Internationales Studierendenforum der European Association for Music in Schools zum Thema “lifelong development”
Universität Mozarteum Salzburg sowie Musikuniversität Wien
Inhaltliche und organisatorische Gesamtkonzeption sowie Durchführung für den Austragungsort Salzburg: Monika Oebelsberger, Gabriele Hofmann und Gerhard Sammer.
Im Rahmen des Internationalen Musik-Kongresses der European Association for Music in Schools (EAS) fand das zweite Internationale Studierendenforum in Salzburg und Wien statt. Studierende von 16 Universitäten aus der Schweiz, Griechenland, Tschechische Republik, Ungarn, Slowakei, Deutschland und Österreich widmeten sich dem Kongressthema lifelong development aus musikpädagogischer Sicht und präsentierten die im Studierendenforum erarbeiteten Ergebnisse im Rahmen des Kongresses in Wien.
Im Mittelpunkt stand der Gedanke, dass dem Zeitraum eines etwa fünfjährigen Studiums ein Berufsleben gegenübersteht, das ein Mehrfaches dieser Spanne umfasst. Im Sinne des lifelong development ist es ein Ziel, Erwerb, Förderung und Erhaltung von Fähigkeiten, Interessen, Wissen und Qualifikationen während des gesamten (Berufs-)lebens durch den Einsatz verschiedener Arten des Lernens zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, welche Möglichkeiten für MusiklehrerInnen bestehen, während des Berufslebens einerseits fachliche Kompetenz, andererseits aber auch allgemeine qualitative Verbesserung des Berufsalltages und eigene berufliche Zufriedenheit zu erhalten und/oder entwickeln.
Ausgehend von den aktuellen Standorten der Studierenden in ihren jeweiligen Ausbildungssituationen in den unterschiedlichen Ländern haben die Studierenden Visionen hinsichtlich der Möglichkeit eines lebenslangen Lernens entwickelt, aus denen sie tatsächliche Perspektiven für eine Gestaltung des Studiums und Berufslebens entworfen haben.
1999: Symposium Mensch & Musik
Inhaltliche Konzeption des Symposiums: Gabriele Hofmann, Claudia Trübsbach. Gesamtmoderation sowie Leitung der Podiumsdiskussion: Gabriele Hofmann.
Gasteig-Kulturzentrum München
Das Symposium lieferte einen Beitrag zur Diskussion zwischen VertreterInnen der Fächer Musik, Musiktherapie, Medizin, Physiologie und Psychologie. Die unterschiedlichsten Aspekte möglicher interdisziplinärer Beziehungen wurden von Prof. Dr. Hans-Helmut Decker- Voigt, Prof. Dr. Heiner Gembris, Prof. Dr. Marianne Hassler, Dr. Albrecht Lahme, Prof. Dr. Helmut Möller, Prof. Dr. Ralph Spintge und Prof. Dr. Dr. Lorenz Welker diskutiert. Es geht unter anderem um:
- Wirkungen von Musik
- Musiktherapie
- Musikalische Begabung und Hochbegabung
- Lampenfieber und Podiumsangst
- Überlastungsbeschwerden bei InstrumentalistInnen
- Musik in der Medizin
- MusikerInnenpersönlichkeit
Das Symposium richtete sich ganz allgemein an Musikinteressierte, im Besonderen aber an Musikausübende, MusiktherapeutInnen, PsychologInnen, ÄrztInnen, Studierende, BerufsmusikerInnen, MusikpädagogInnen und Eltern.
Ziel war es, einer breiteren Öffentlichkeit einige bedeutsame Themen der Systematischen Musikwissenschaft zugänglich zu machen. Es wurde ein Tagungsband herausgegeben.